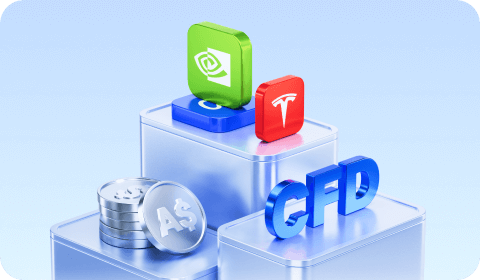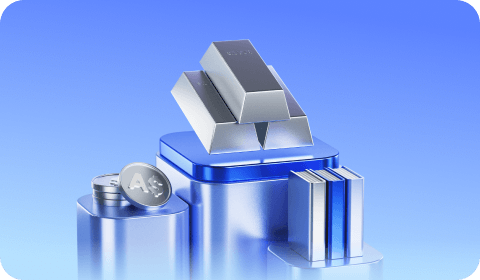EUR/CHF hält sich fest, während der EMI der Eurozone nachlässt und die SNB eine vorsichtige Haltung beibehält
- EUR/CHF stabilisiert sich, während der Euro frühe Verluste nach den vorläufigen PMI-Daten der Eurozone verringert.
- Der PMI der Eurozone signalisiert gemischte, aber schwächere Dynamik, da der verarbeitende Sektor wieder in die Kontraktion rutscht.
- Die Kommentare der SNB bleiben hawkisch, während die Entscheidungsträger eine hohe Hürde für negative Zinsen aufrechterhalten.
Der Euro (EUR) verringert am Freitag einige seiner frühen Verluste gegenüber dem Schweizer Franken (CHF), während sich das Paar nach der Veröffentlichung der vorläufigen Einkaufsmanager-Index (PMI)-Daten der Eurozone stabilisiert. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird das Währungspaar bei etwa 0,9290 gehandelt, nachdem es von einem Intraday-Tief von 0,9276 zurückgekommen ist.
Die PMI-Zahlen der Eurozone lieferten ein gemischtes, aber insgesamt schwächeres Signal für November. Der HCOB Composite PMI fiel von 52,5 auf 52,4 und verfehlte die Erwartungen. Während der PMI für den Dienstleistungssektor mit 53,1 ein 18-Monats-Hoch erreichte und über den Prognosen lag, hatte der verarbeitende Sektor weiterhin Schwierigkeiten, da der PMI für das verarbeitende Gewerbe mit 49,7 wieder in die Kontraktion fiel, unter dem Konsens von 50,2 und dem vorherigen Wert von 50,0.
Die Schwäche war in Deutschland ausgeprägter, wo die PMI-Zahlen die Prognosen in allen Bereichen verfehlten. Der Composite PMI kühlte stark von 53,9 auf 52,1 ab, während der PMI für das verarbeitende Gewerbe tiefer in die Kontraktion bei 48,4 fiel und der Dienstleistungssektor auf 52,7 nachgab, beides weit unter den Erwartungen. Die Daten signalisierten eine nachlassende Wachstumsdynamik in der größten Volkswirtschaft Europas, mit rückläufigen neuen Aufträgen und einem schnelleren Rückgang der Beschäftigung.
Im Gegensatz dazu zeigte Frankreich Anzeichen der Stabilisierung, da der Composite PMI stark von 47,7 auf 49,9 anstieg, unterstützt durch die erste Expansion der Dienstleistungsaktivitäten in 15 Monaten. Allerdings schwächte sich die französische Industrie weiter auf 47,8 ab, was das gesamte Umfeld fragil hält.
Kommentare von Vertretern der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag trugen wenig zur Verbesserung der Stimmung rund um den Euro bei. Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte, dass die EZB „ihren Teil zur Gewährleistung der Preisstabilität beiträgt“ und betonte, dass die Entscheidungsträger „die Politik nach Bedarf anpassen werden“, um die Inflation auf Kurs zum Ziel zu halten. Vizepräsident Luis de Guindos unterstützte diese Haltung und merkte an, dass das aktuelle Zinsniveau „angemessen“ sei und hob die anhaltende Mäßigung der Dienstleistungsinflation hervor.
In der Schweiz verstärkten die Kommentare von Vertretern der Schweizerischen Nationalbank (SNB) die vorsichtige Haltung der Zentralbank. Vorsitzender Martin Schlegel stellte fest, dass die Hürde für die Rückkehr zu negativen Zinsen „hoch“ bleibt, betonte jedoch, dass die SNB bereit ist, die Zinsen bei Bedarf zu senken. SNB-Vorstandsmitglied Petra Tschudin fügte hinzu, dass die Inflation in den kommenden Quartalen voraussichtlich leicht steigen wird. Die SNB wird ihre nächste Zinssatzentscheidung im Dezember treffen, wobei Analysten allgemein erwarten, dass die Zentralbank die Zinsen unverändert bei 0% belässt.
SNB - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) steuert die Geldpolitik des Landes und strebt eine jährliche Inflationsrate von unter 2 % an, um Preisstabilität zu gewährleisten.
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) legt die Zinssätze fest, um die Preisstabilität zu gewährleisten. Wenn die Inflation über das Ziel hinausgeht, erhöht die SNB die Zinsen, um das Preiswachstum zu dämpfen. Höhere Zinsen stärken den Schweizer Franken (CHF), während niedrigere Zinsen ihn schwächen.
Die SNB greift zudem regelmäßig in den Devisenmarkt ein, um eine übermäßige Aufwertung des Schweizer Frankens zu verhindern, da ein starker Franken die Wettbewerbsfähigkeit der exportorientierten Schweizer Wirtschaft belastet. Zwischen 2011 und 2015 führte die SNB sogar eine feste Bindung des Frankens an den Euro ein, um dessen Aufwertung zu stoppen. Heute interveniert die Bank, indem sie ihre umfangreichen Devisenreserven nutzt, um Fremdwährungen wie den US-Dollar oder den Euro zu kaufen. In Zeiten hoher Inflation, insbesondere getrieben durch steigende Energiepreise, verzichtet die SNB jedoch auf Eingriffe, da ein starker Franken die Energieimporte verbilligt und so den Inflationsdruck auf Schweizer Haushalte und Unternehmen mildert.
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) überprüft viermal jährlich, im März, Juni, September und Dezember, ihre geldpolitische Ausrichtung. Dabei veröffentlicht sie auch eine mittelfristige Inflationsprognose, die in den darauffolgenden Monaten das geldpolitische Umfeld maßgeblich prägen kann.